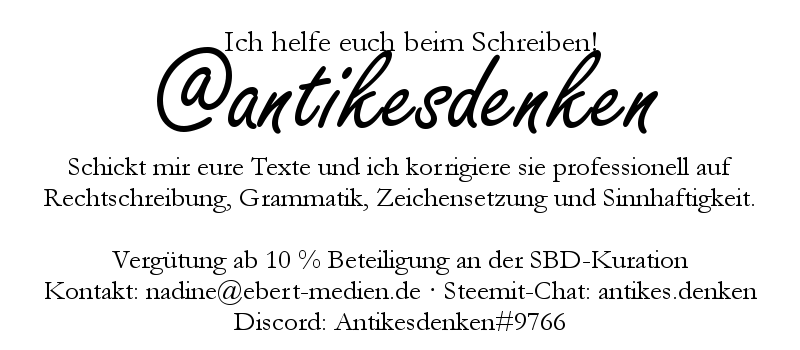Der Konstruktivismus ist die Fortführung des kritischen Rationalismus (bei Kant).
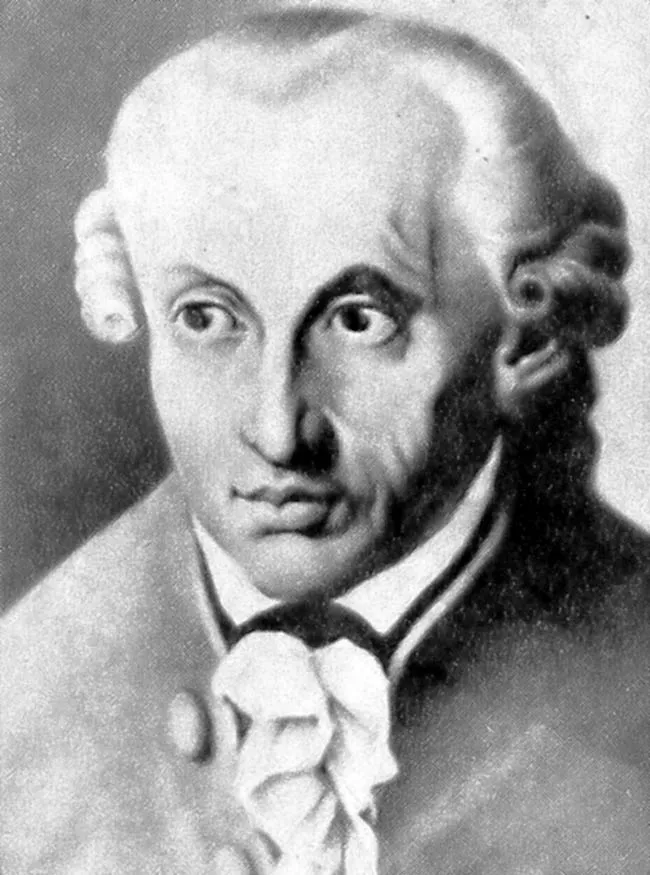
Das ist Teil 3 meiner 7-teiligen Serie über das Thema Konstruktivismus.
Im zweiten Teil bin ich darauf eingegangen, dass der Konstruktivismus an den antiken Skeptizismus anknüpft. Im dritten Teil möchte ich darauf eingehen, dass der Konstruktivismus die Fortführung des kritischen Rationalismus (bei Kant) ist.
Ich hatte ursprünglich vor, die kommenden Teile der Serie in kleine Blöcke, wie in diesem Beitrag hier, einzuteilen, also insgesamt 12 Teile. Da dadurch aber möglicherweise die Übersichtlichkeit bzw. der Zusammenhang verloren gehen, werde ich sie zusammenfassen. Die nächsten Teile der Serie werden daher deutlich länger. Danke für euer Verständnis und weiter viel Spaß beim Lesen.
Kants kritischer Realismus
Auch Kant war ein Skeptiker, insofern er dem Empirismus, der Erkenntnis vor allem aus den Sinneserfahrungen ableitete, eine Absage erteilte. Er weicht den Dualismus von Objekt und Subjekt auf und sagt, dass das Subjekt das Objekt erst macht: Kein Objekt ohne Subjekt und umgekehrt. Damit läutete er die „kopernikanische Wende“ ein: Denn der Grund dafür, dass wir ein Objekt so und nicht anders erfahren, wird nicht mehr im Objekt, sondern im sinnlich erfahrenden Subjekt gesehen.
Diese Erkenntnis läutet eine Zeitenwende („Revolution der Denkungsart“) ein. Damit hat sein kritischer Realismus eine ähnliche Auswirkung wie die astronomische Entdeckung von Kopernikus, der das von der Kirche geprägte Weltbild auf den Kopf stellte. Als er klarstellte, dass sich die Sonne nicht um die Erde, sondern die Erde um die Sonne drehe, wir also nicht mehr Mittelpunkt des Universums sind, nahm er dem Menschen den Glauben an die Sonderstellung seines Planeten im Weltraum.
Analog dazu hat Kant das zu erkennende Objekt als „Zentrum der Wahrheit“ abgeschafft und die Möglichkeit wahrer Erkenntnis in das erkennende Subjekt verlegt. Die Kriterien, anhand der Mensch die reine Vernunft theoretisch anwendet, sind die Kategorien: Quantität, Qualität, Relation und Modalität.
Kant unterscheidet zwischen der Erscheinung (Phänomen) und dem „Ding an sich“ (Noumena). Seine Transzendentalphilosophie leugnet weder die Wirklichkeit noch die tatsächliche Existenz des Objekts, er sagt lediglich, dass wir es niemals in seiner ganzen Transzendenz erfassen können. Insofern sind wir gewissermaßen “Gefangene unserer Sinne.“.
Ein Objekt könne ihm niemals anders als in der Erscheinung vorkommen. Trotz seiner kritischen Aussage darüber, dass sich das Ding an sich im Rahmen des theoretischen Gebrauchs der reinen Vernunft niemals klar erfassen ließe und seiner Nähe zum Skeptizismus, richtet er seine Philosophie in der Kritik der praktischen Vernunft noch immer darauf aus, Aussagen über metaphysische Begriffe zu machen (z. B. über die Existenz Gottes).
Deswegen kann man Kant zwar zu den Wegbegründern konstruktivistischen Denkens zählen, er selbst ist jedoch kein Konstruktivist gewesen.
Nächstes Thema: die Ontologische Systematisierung des Konstruktivismus |
|---|
Literatur
- Jean Grondin: Immanuel Kant zur Einführung, Hamburg 2013.
- siehe auch Literaturangaben im ersten Teil der Serie
Gerade veröffentlicht:
[ENG] My steemit pearls week 13
[DE] Die Veggie-Meldung der Woche: KW 13
[DE] Nur ein Traum
[DE - ENG] Breakfast recipe: semolina pudding and compote according to the Traditional Chinese Diet
[DE] Ich helfe euch beim Schreiben
Bildquellen:
1
Icon made by https://www.flaticon.com/authors/freepik from https://www.flaticon.com
 |
|  |
|  |
|  }
}04.04.2018 UTC + 1