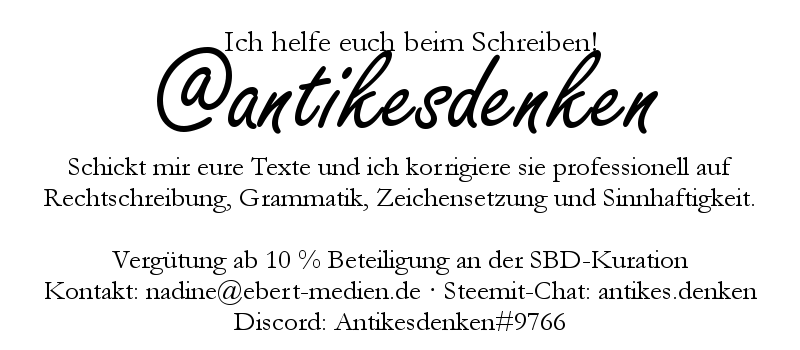Unsere Wahrnehmung steckt in einer Krise.
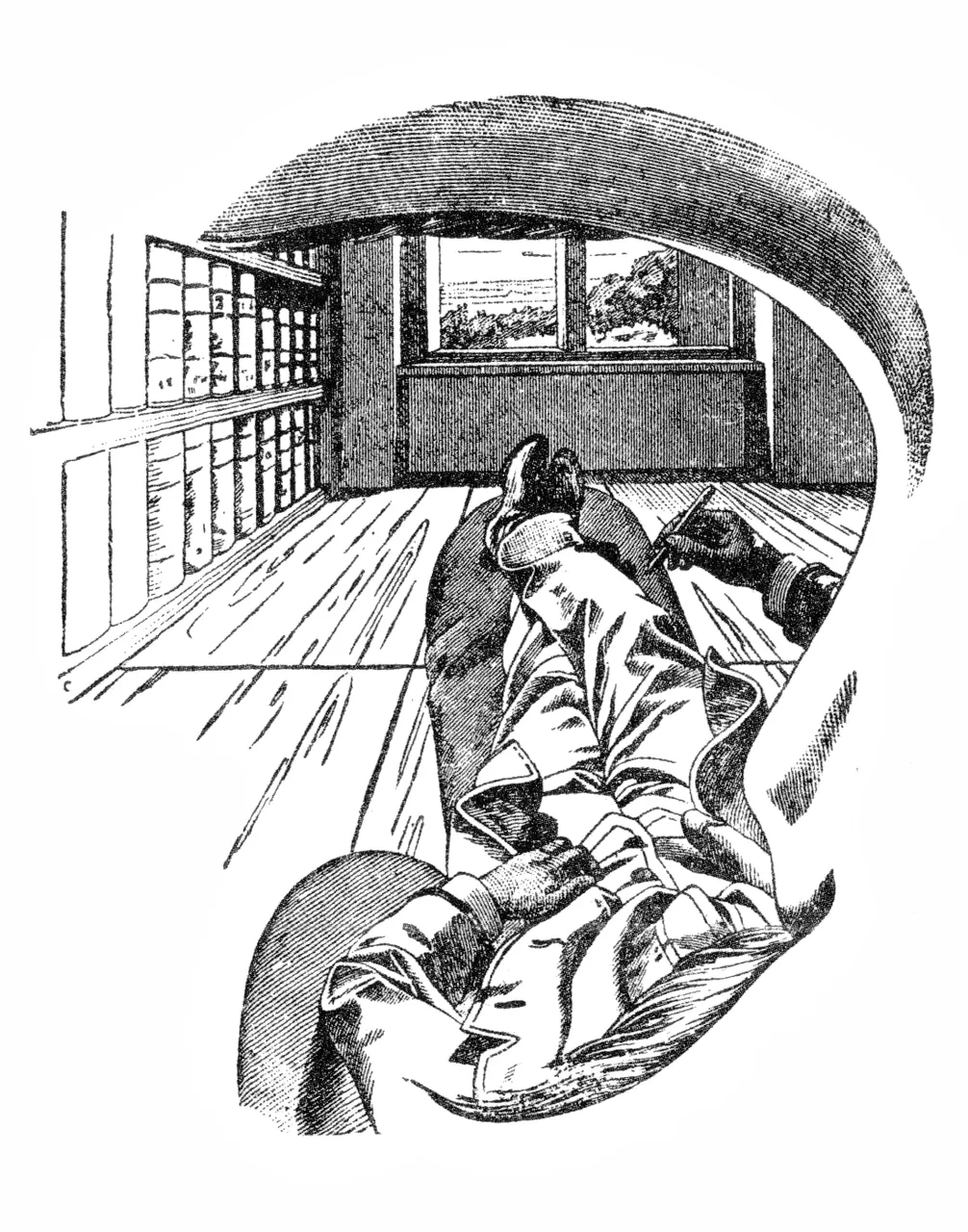
Ich starte eine 7-teilige Serie über das Thema Konstruktivismus. Das ist ein Begriff, der in der Medientheorie eine große Rolle spielt. Der Konstruktivismus hat mich früher sehr beschäftigt und beschäftigt mich, in einem gewissen Sinne, noch immer.
Heute gehe ich jedoch ganz anders, weniger wissenschaftlich, sondern natürlich und intuitiv mit der Frage "Leben wir alle nur in unserem eigenen Traum?" um.
Der Konstruktivismus hingegen möchte möglichst wissenschaftlich zeigen, an welchen Stellen unsere Gesellschaft heute, und auch in viel früheren Tagen der Menschheitsgeschichte, Krisen produzierte, die auf Annahmen und Konventionen beruhten, für die es keine Grundlage gibt.
Das Kernthema meiner Untersuchung ist nicht der Konstruktivismus an sich, sondern eigentlich der Radikale Konstruktivismus. Ich werde in einem späteren Teil der Serie auf die Systematisierung des Konstruktivismus eingehen.
Im ersten Teil skizziere ich eine mögliche Definition des Konstruktivismus, die auf der These beruht, dass unsere Wahrnehmung in einer Krise steckt.
Ich werde die Serie mit einer Zusammenfassung aller Beiträge und einem persönlichen Resümee abschließen.
Ich freue mich über eure Rückmeldungen!
Die moderne Krise der Wahrnehmung
Der Konstruktivismus ist die vierte Krise der westlichen Zivilisation.
Der Konstruktivismus ist eine philosophische Strömung bzw. „Denkungsart“ der Postmoderne, die der Erkenntnistheorie zugehört. Der umwälzende Charakter des Konstruktivismus ist so gravierend wie die ihr vorausgehenden drei Krisen der westlichen Zivilisation. Ihm liegt die „moderne Krise der Wahrnehmung“ zugrunde.
Zu den drei Krisen der westlichen Zivilisation gehören
- die Aufgabe des geozentrischen Weltbilds zu Gunsten des heliozentrischen Weltbilds (Galilei), die die „kopernikanische Wende“ einleitete. Des Weiteren
- die Evolutionstheorie Darwins, dessen Theorie den Menschen an seiner Sonderstellung im Tierreich zweifeln ließ, da er gemeinsame Vorfahren mit dem Affen hat.
- Die Krise der Psychologie besteht darin, dass, nach Freuds Entdeckung des Unbewussten, der Mensch nicht mehr „Herr im eigenen Haus“ ist.
In der Postmoderne trat eine vierte Krise auf:
Die Krise der Wahrnehmung
Wahrnehmung wird jetzt im neurobiologischen Kontext darauf reduziert, dass neuronalen Prozessen (also die Information „so und soviel Reizempfang an dieser Nervenzelle“), keine objektive Bedeutung mehr beigemessen wird. Stattdessen wird die systeminterne Verarbeitung, anhand der ein subjektives Wirklichkeitskonstrukt aufgebaut wird, das passt, obwohl es keine ontologische Realität abbildet, hervorgehoben.
Die Krise der Wahrnehmung leitet sich aus der Tradition des kritischen Realismus ab, der mit der kopernikanischen Wende begann. Ihre Entdeckung ist ein „Kind der Aufklärung“ und orientiert sich an neuzeitlichen Philosophen der Aufklärung wie Locke, Hume, Kant und Descartes.
Die Krise der Wahrnehmung ist gleichzeitig eine Krise der Kommunikation. Einerseits ist es, wie uns der kommunikative Konstruktivismus lehrt, nicht möglich, nicht zu kommunizieren (Watzlawick), andererseits ist es, wie uns die Diskurstheorie des Konstruktivismus lehrt, nicht möglich, ohne Referenz, also besonders originell, zu kommunizieren (Gergen/Davis).
Nächstes Thema: die Geschichte des Konstruktivismus |
|---|
Literatur
- Bubenhofer, Noah (2007). Kreative Konstruktion: Einführung in den Konstruktivismus.
- Fischer, Hans R. (1995). „Abschied von der Hinterwelt?“: Zur Einführung in den Radikalen Konstruktivismus. In: Fischer, Hans R. (Hrsg.). Die Wirklichkeit des Konstruktivismus: Zur Auseinandersetzung um ein neues Paradigma, Heidelberg: 11 - 34.
- Foerster, Heinz von (1992). „Entdecken oder Erfinden“: Wie läßt sich Verstehen verstehen?. In: Glasersfeld, Ernst von, Foerster, Heinz von, Watzlawick, Paul. Einführung in den Konstruktivismus, München 82005: 41 - 88.
- Glasersfeld, Ernst von (1992). „Konstruktion der Wirklichkeit und des Begriffs der Objektivität“. In: Foerster, Heinz von. Einführung in den Konstruktivismus, München 82005: 9 - 39.
- Glasersfeld, Ernst von (1997). Radikaler Konstruktivismus: Ideen, Ergebnisse, Probleme. [Radical Constructivism. A way of Knowing and Learning], Frankfurt am Main.
- Hejl, Peter M. (1992). „Konstruktion der sozialen Konstruktion“: Grundlinien einer konstruktivistischen Sozialtheorie. In: Glasersfeld, Ernst von, Foerster, Heinz von, Watzlawick, Paul. Einführung in den Konstruktivismus, München 82005: 109 -146.
- Knorr-Cetina, Karin (1989). “Spielarten des Konstruktivismus“: Einige Notizen und Anmerkungen. In: Soziale Welt 40: 86 - 96.
- Lohmann, Georg. (1994). “Beobachtung“ und Konstruktion von Wirklichkeit“: Bemerkungen zum Luhmannschen Konstruktivismus. In: Rusch, Gebhard., Schmidt, Siegfried J. (Hrsg.). Konstruktivismus und Sozialtheorie, Frankfurt am Main: 205 - 219.
- Maturana, Humberto R. (1982). Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit, Braunschweig.
- Maturana, Humberto R. (2001). Was ist erkennen? Die Welt entsteht im Auge des Beobachters, München.
- Oeser, Erhard, Seitelberger, Franz (1988). Gehirn, Bewusstsein und Erkenntnis, Darmstadt.
- Rorty, Richard M. (1967). The linguistic turn: Essays in Philosophical Methods, Chicago 1975.
- Rusch, Gebhard (1987). Erkenntnis, Wissenschaft, Geschichte: Von einem konstruktivistischen Standpunkt, Frankfurt.
- Scheffer, Bernd (1992). Interpretation und Lebensroman: Zu einer konstruktivistischen Literaturtheorie, Frankfurt am Main.
- Schmidt, Siegfried J. (1980). Grundriß der Empirischen Literaturwissenschaft, Bd.1, Braunschweig.
- Schmidt, Siegfried J. (Hrsg.) (1987) Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt am Main 92003.
- Schmidt, Siegfried J. (1998). Die Zähmung des Blicks: Konstruktivismus – Empirie – Wissenschaft, Frankfurt am Main.
- Schmidt, Siegfried J. (1993). „Kommunikation – Kognition – Wirklichkeit“. In: Bentele, Günther, Rühl, Manfred (Hrsg.). Theorien öffentlicher Kommunikation: Problemfelder, Positionen, Perspektiven, München: 105 - 117.
- Spence, Donald P. (1998). „Das Leben rekonstruieren“: Geschichten eines unzuverlässigen Erzählers. In: Straub, Jürgen (Hrsg.). Erzählung, Identität und historisches Bewusstsein: Die psychologische Konstruktion von Zeit und Geschichte, Bd. 1, Frankfurt am Main: 203 - 225.
- Watzlawick, Paul (1981). „Bausteine ideologischer “Wirklichkeiten““. In: Watzlawick, Paul (Hrsg.). Die erfundene Wirklichkeit: Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus, München 41986: 192 - 228.
- Watzlawick, Paul (1992).„Wirklichkeitsanpassung oder angepaßte “Wirklichkeit“?“: Konstruktivismus und Psychotherapie. In: Glasersfeld, Ernst von, Foerster, Heinz von, Watzlawick, Paul. Einführung in den Konstruktivismus, München 82005: 89 -107.
- Weber, Stefan (2003). „Konstruktivistische Medientheorien“. In: Weber, Stefan (Hrsg.). Theorien der Medien: Von der Kulturkritik bis zum Konstruktivismus, Konstanz: 180 - 200.
- Zitterbarth, Walter (1995). „Erkenntnistheorie und Repräsentation“. In: Fischer, Hans R. (Hrsg.). Die Wirklichkeit des Konstruktivismus: Zur Auseinandersetzung um ein neues Paradigma, Heidelberg: 93 - 102.
Bildquellen:
1
Icon made by https://www.flaticon.com/authors/freepik from https://www.flaticon.com
Gerade veröffentlicht:
[ENG] My steemit pearls week 13
[DE] Die Veggie-Meldung der Woche: KW 13
[DE - ENG] Breakfast recipe: semolina pudding and compote according to the Traditional Chinese Diet
[DE] Ich helfe euch beim Schreiben
 |
|  |
|  |
|  }
}02.04.2018 UTC + 1