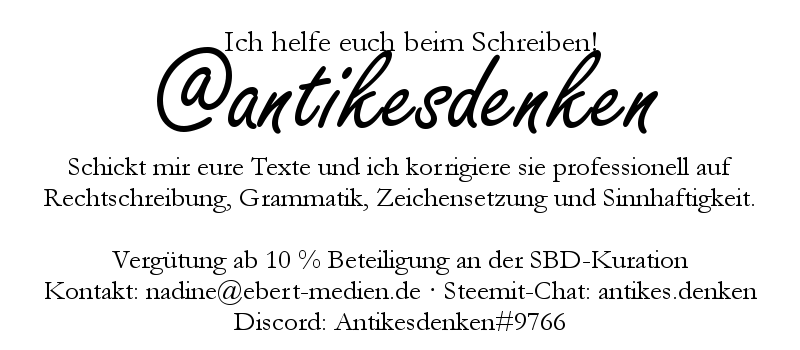Entsteht Wirklichkeit ausschließlich im sozialen Prozess?

Das ist Teil 6 meiner 7-teiligen Serie über das Thema Konstruktivismus.
Im 5. Teil bin ich auf zwei populäre Einwände, die vor allem den radikalen Konstruktivismus betreffen, eingegangen: den Vorwurf, eine "erkenntnislose Erkenntnistheorie" zu sein, also keine Objektivität bieten zu können, sowie die Beliebigkeitsthese.
Im 6. Teil stelle ich die erweiterte Theorie des sozialen Konstruktivismus anhand des kommunikativen und des empirischen Konstruktivismus vor.
Soziologische Varianten des Konstruktivismus

Wir haben gesehen, dass der radikale Konstruktivismus auf den Einwand der Beliebigkeitsthese mit der Möglichkeit des Abgleichens der eigenen Wirklichkeitsauffassung mit der von anderen psychischen Systemen antwortet.
Trotz der Zugeständnisse, die der radikale Konstruktivismus in seiner soziologischen Variante an eine (mögliche) Außenwelt macht, verharrt er als "epistomologischer Solipsismus" in der Meinung
daß alle meine Aussagen über diese Wirklichkeit zu hundert Prozent mein Erleben sind.
Schmidt, Siegfried J. (Hrsg.) (1987) Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt am Main 92003: 35.
Um die Theorie des radikalen Konstruktivismus weiterhin konsistent zu halten, muss aber der Status, den andere für das psychische System haben, untersucht werden. Die Frage muss also lauten: Wie kann der Abgleich der eigenen Wirklichkeitsauffassung mit der anderer psychischer Systeme von statten gehen und gleichzeitig weiterhin eine Aussage über die Ontologie vermieden werden?
Der soziale Konstruktivismus

Die These des sozialen Konstruktivismus lautet: Wir konstruieren Wirklichkeit ausschließlich im sozialen Prozess.
Der soziale Konstruktivismus stützt sich nicht wie die Autopoiesis-Theorie auf die Subjektivität als einzigen Bezugsrahmen für die Wirklichkeitskonstruktion, sondern behauptet in seiner radikalen Variante (Gergen, Berger/Luckman, Frindte), dass Realität ausschließlich im sozialen Diskurs entsteht.
Wenn Menschen keinen subjektiven Wirklichkeitsbegriff erzeugen können, sondern dieser ausschließlich über den Abgleich mit anderen hergestellt wird, ist aber wiederum nicht zu erklären, wie es jemals dazu kommen konnte, dass Individuen in einer Gruppe einen gemeinsamen Begriff von Wirklichkeit erzeugten.
Wäre es tatsächlich so, könnte man dem sozialen Konstruktivismus vorwerfen, dass er sich zu seiner eigenen zirkulären Voraussetzung macht (petitio principii, Inanspruchnahme des Beweisgrundes). Das ist freilich nicht der Fall. Erkennbar wird das aber erst, wenn man sich den Weg des Menschen zur Gesellschaft ansieht.
Der Weg des Menschen zur Gesellschaft

Der Mensch wurde im Laufe der Evolution in die möglicherweise verhängnisvolle Lage versetzt, über sich selbst zu reflektieren. Das heißt, es wurde ihm möglich, aus mehreren Handlungsalternativen zu wählen, wenn es ein Problem zu lösen gab.
Jeder Handlungsalternative liegt aber auch eine Wirklichkeitskonstruktion (ein Sinn) zugrunde. Da der Mensch erfahren hat, dass verschiedene Handlungsstrategien zum Ziel führen können, musste er sich grundsätzlich unschlüssig darüber sein, welche Handlungsstrategie er seinem Handeln zugrunde legen sollte, wenn er nicht scheitern wollte. Durch die Kontingenz konnte ein kohärentes Weltbild nicht aufrechterhalten werden.
Es reichte also nicht mehr eine valide Handlungsstrategie aus den vielen erlernten Möglichkeiten auszuwählen. Weil er sich durch das Auftreten der Kontingenz der miteinander konkurrierenden Realitätsdefinitionen, die allen Handlungsstrategien zugrunde liegen, bewusst wurde.
Er brauchte eine neue Sinn vermittelnde Komponente, die ihm Aufschluss darüber gibt, welche Wirklichkeitskonstruktion (bzw. Realitätsdefinition) er für das Lösen eines bestimmten Problems zugrunde legen sollte.
Diese sinnvermittelnde Instanz ist die Gesellschaft. Dort, wo man sich in sozialen Systemen auf eine Handlungsweise zur Problemlösung geeinigt hatte, konnten Individuen ihre zahlreichen Realitätsdefinitionen aufgeben und mit der sozial bestätigten Realitätsdefinition ersetzen.
Gleichzeitig wurden die frei gewordenen Hirnkapazitäten dazu benutzt, parallele Handlungsstrategien und die ihnen zugrunde liegenden Realitätsdefinitionen für einen späteren Gebrauch abzuspeichern.
Allein im Dschungel: Soziale Rejektion

Die Theorie darf jedoch nicht dahingehend ausgeweitet werden, dass es dem Menschen ausschließlich Vorteile bringt, sich einer bzw. mehreren Gruppen anzuschließen. Da das Individuum in der Moderne als Schnittstelle mehrerer sozialer Systeme fungiert, sieht es sich mehreren heterogenen Lebenswelten ("Parallelwelten") ausgesetzt.
Es spaltet sich im Zuge dessen in mehrere persona (Rollen bzw. Masken) auf. Das heißt auch, dass es Anteil an mehreren konkurrierenden Lebenskonzepten hat. Ist es ihm nicht möglich, diese miteinander zu vereinbaren, kann das zu einer Krise führen, da es seinem Handeln fortan kein kohärentes Weltbild mehr zugrunde legen kann.
Soziale Aussteiger

Peter Hejl führt als eine mögliche Folge einer solchen Krise die Ablehnung aller angebotenen Alternativen ("soziale Rejektion") an, wie wir sie beispielsweise im sozialen Aussteiger finden.
Die Theorie, dass die Teilhabe an sozialen Systemen immer von Vorteil ist, ist bei zunehmender Komplexität der Gesellschaftssysteme also äußerst fragwürdig.
Der Verlust einer objektiven Wahrheit ist das Kernproblem des postmodernen Bewusstseins.
Gergen, Kenneth J. (1990): "Construction Of Self In The Postmodern Age". Psychologische Rundschau. Volume 41, Issue 4. 191-199: 191.
Eine Gesellschaftstheorie, die sich nur auf die sozial konstruierte Realität stützt und dem Einzelnen keinen Gestaltungsspielraum mehr ermöglicht, läuft also Gefahr, sich selbst zu demontieren. Adorno und Horkheimer haben diesen gefährlichen Zustand in Die Dialektik der Aufklärung sehr schön mit dem Satz zusammengefasst:
Man hat nur die Wahl, mitzutun oder hinterm Berg zu bleiben.
Horkheimer, Max; Adorno, Theodor W. (1947): Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Frankfurt/M. 1998: Fischer: 156.
Der kommunikative Konstruktivismus

Kommunikation ist unwahrscheinlich.
Anschaulich wird der soziale Konstruktivismus erst dort, wo subjektives Wissen übertragen wird, um als intersubjektives Wissen in den Kulturkreis einzugehen und zu kollektivem Wissen zu werden. Da wir Wissen sprachlich weitergeben, musste zeitgleich mit dem Aufkommen von Kultur auch Sprache entstanden sein.
Doch auch in der Sprache gibt es einen Konstruktivismus. Es ist nicht möglich, wahrzunehmen, was jemand objektiv sagt, sondern nur, was man selbst (systemintern) konstruiert. Wir referieren beim Sprechen also nicht auf den tatsächlichen Sinn, also eine zugrundeliegende Weltsicht, sondern auf eine Handlungsweise, der ein Sinn bzw. eine Weltsicht lediglich (als unkommunizierbar) zugrunde liegt.
Spiegeln am Anderen (Strukturdeterminismus, Reziprozität der Perspektiven)

Der kommunikative Konstruktivismus überträgt das Postulat der Systemgeschlossenheit der Autopoiesis-Theorie von Maturana und Valera auf die Kommunikation zwischen zwei Menschen.
Kommunikation im Sinne eines Informationsaustausches wie etwa beim Sender-Empfänger-Modell von Shannon-Weaver findet aufgrund des Strukturdeterminismus nicht statt. Man kann sich das so vorstellen als würden sich zwei Spiegel gegenüberstehen: Jedes psychische System reagiert auf den Reiz, den es vom Gegenüber erfährt, mit geänderter Wirklichkeitswahrnehmung und gibt diese über einen Reiz (die Sprache) wieder.
Der Äußerung einer Handlungsstrategie wird aufgrund dieses Koppelungsprozesses ein Sinn subjektiv „untergeschoben“ und als „objektiv“ institutionalisiert. Damit findet der Sinn Eingang in das kollektive Wissen.
Dieses wird wiederum in Zeichen übersetzt und von den Individuen übernommen. Fortan können sich Individuen darüber verständigen, welche Handlungsstrategie mit einem zu lösenden Problem in Beziehung gebracht wird.
Das können sie, obwohl das der Handlungsstrategie zugrunde liegende Konstrukt der Wirklichkeit (der Sinn) als Institution nicht objektiv ist. Der mit der Handlungsstrategie verknüpfte Sinn gibt die „dahinterliegende“ Ontologie nicht objektiv wieder. Objektivität hat das Wissen vor allem dadurch, dass Problemlösungsverfahren als soziale Institutionen bzw. Paradigmen in das kollektive Wissen eingegangen sind.
Der empirische Konstruktivismus
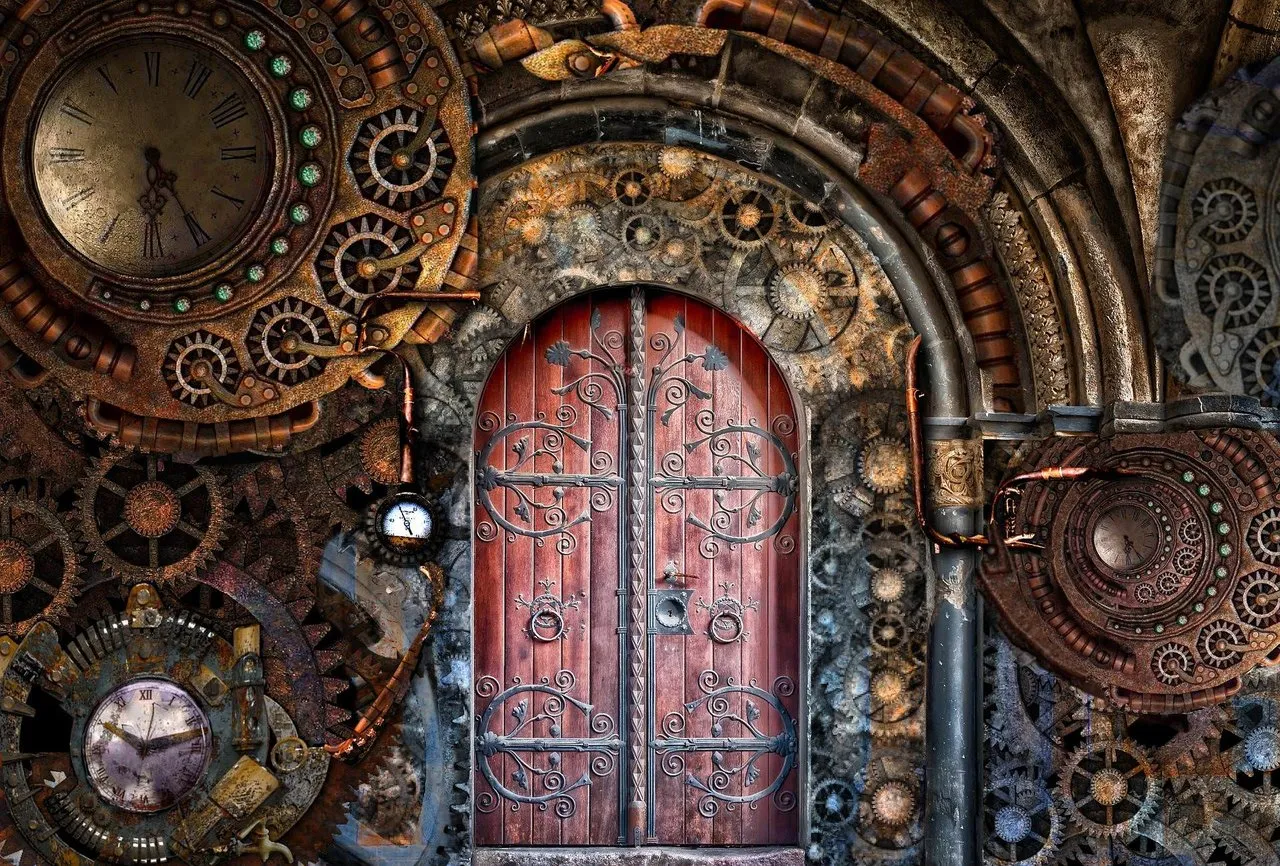
Der empirische Konstruktivismus geht davon aus, dass die Naturwissenschaften nicht Realität, sondern nur (bis jetzt) stabile Beschreibungen der Realität (Theorien) (er)finden.
Der empirische Konstruktivismus löst sich von Institutionen und geht davon aus, dass Objektivität nur noch situativ durch wissenschaftliche Beobachtung gestiftet wird. Gegen den empirischen Konstruktivismus ist deswegen eingewendet worden, soziale Institutionen zu übergehen.
An die Stelle sozialer Institutionen treten allerdings Normen, Evidenzen und Kriterien, die auf der Beobachterebene zweiter Ordnung aus der Beobachtung der Beobachterebene erster Ordnung gewonnen wurden. Diese beobachteten Differenzen gehen als Theorien (sozusagen manifest gewordene Einheiten) bei zukünftigen wissenschaftlichen Beobachtungen in einen Pool bereits vorhandener Normen, Kriterien und Evidenzen des jeweiligen Wissenschaftsbetriebs mit ein.
Letztere sind, weil sie ihrem Ursprung nach einem sozialen System entsprangen (einer bestimmten Wissenschaft, die auf ihren eigenen Glaubenssätzen aufbaut und einem Wissenschaftsbetrieb unterliegt), nicht letztbegründbar und daher nicht objektiv.
Die so gewonnenen Annahmen tragen aber dazu bei, stabile Aussagen über die Klassifikation von Gegenständen aufzustellen (also z. B. etwas über die Art zu sagen, wie ein Gegenstand beschaffen ist). So entstehen Theorien, die auf Konstruktionen beruhen, weil sie nicht als ontologisch wahr vorausgesetzt werden dürfen, solange es möglich ist, dass eine Theorie mit höherer Konsistenz diese ablöst.
Letztere Erkenntnis führt zur Selbstverpflichtung der empirischen Wissenschaften zum Theorienpluralismus.
Nächstes Thema: Zusammenfassung und Ausblick |
|---|
Literatur
- Dietrich Busse (1995): Sprache, Kommunikation, Wirklichkeit, in: Fischer, Hans R. (Hrsg.). Die Wirklichkeit des Konstruktivismus: Zur Auseinandersetzung um ein neues Paradigma, Heidelberg: 253 - 265.
- Fischer, Hans R. (1995). Sprache und Wirklichkeit. Eine unendliche Geschichte, in: Fischer, Hans R. (Hrsg.). Die Wirklichkeit des Konstruktivismus: Zur Auseinandersetzung um ein neues Paradigma, Heidelberg.
- Watzlawick, Paul 82005: Wirklichkeitsanpassung oder angepasste Wirklichkeit?, in: Glasersfeld, Ernst von, Foerster, Heinz von, Watzlawick, Paul. Einführung in den Konstruktivismus, München: 89 - 107.
Schmidt, Siegfried J. (Hrsg.) (1987) Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt am Main 92003. - http://studienseminar.rlp.de/fileadmin/user_upload/studienseminar.rlp.de/bb-nr/fl-grafik/Sozialwissenschaften/Sozialkonstruktivismus-HorstSiebert.pdf
- Kenneth J. Gergen, Mary Gergen: Einführung in den sozialen Konstruktionismus, Heidelberg 2009.
- Matthies, Ellen: Sozialer Konstruktivismus - eine neue Perspektive in der Psychologie, in: Siegfired J. Schmidt (Hrsg.) Kognition und Gesellschaft: Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus 2, Frankfurt am Main 1991.
- Wolfgang Frindte: Radikaler Konstruktivismus und Social constructivism, in: Hans R. Fischer: Die Wirklichkeit des Konstruktivismus, Heidelberg 1995.
- Peter Hejl: Konstruktion der sozialen Konstruktion, in: Heinz von Foerster (Hrsg.), Ernst Glaserfeld (Hrsg.) et al.: Einführung in den Konstruktivismus, München 1985.
- Paul Feyerabend: Erkenntnis für freie Menschen, Frankfurt 1980.
- siehe auch Literaturangaben im ersten Teil der Serie
Aktuelle Beiträge
[ENG] My steemit pearls week 14 ⚪
[DE - ENG] Korsika-Impressionen // Corse impressions
[DE] Die Veggie-Meldung der Woche: KW 14 🌱 💡
[DE] Konstruktivismus, 5/7, Populäre Einwände
[DE] Konstruktivismus, 4/7, Ontologische Systematisierung
Bildquellen
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Icon made by https://www.flaticon.com/authors/freepik from https://www.flaticon.com
 |
|  |
|  |
|  }
}09.04.2018 UTC + 1