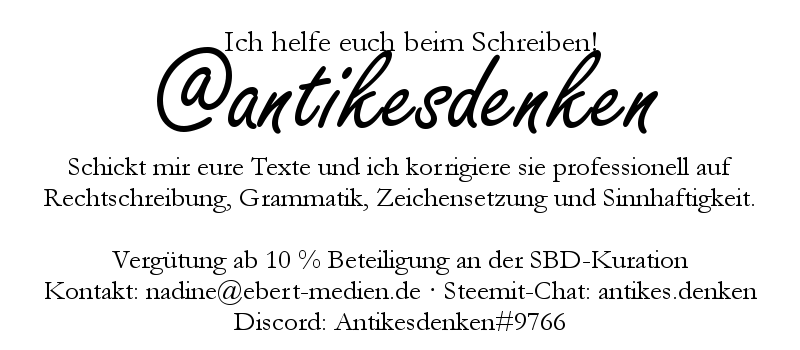Konstruktion als bewusste Strategie?

In einem meiner vorherigen Posts habe ich die These aufgestellt, dass Medien uns Rituale bieten, um uns aufzufangen, wenn wir aus unserem „individuellen, kleinen Kreis“ (unserer Familie) herausfallen.
In diesem Beitrag versuche ich herauszuarbeiten, wie die konstruktivistische Medientheorie zu diesem Thema steht.
Die konstruktivistische Medientheorie
Momentan schwanke ich zwischen zwei Gedankengängen: Einerseits spiegeln uns Filme Bruchstücke unserer eigenen Weltinterpretation wieder. Sie konfrontieren uns also mit dem, woran wir, bewusst oder unbewusst, ohnehin schon glauben. Besonders dann, wenn sie sich Modelle unseres evolutionären oder kulturellen Gedächtnisses bedienen wie Peter Jackson in der Herr der Ringe.

Andererseits folgen Filme immer einer fremden, gefilterten Wahrnehmung (z. B. der eines Protagonisten oder eines Erzählers) und bieten uns damit auch neue Modelle einer möglichen Weltinterpretation an. Doch es ist letztendlich die Wahrnehmung eines Regisseurs, von der das Weltmodell ausgeht.
Spiegeln Filme uns tatsächlich einfach nur Bruchstücke unserer Weltinterpretation wieder, die überindividuellen Wahrheiten entsprechen (wie zum Beispiel dem Monomythos), damit wir uns darin spiegeln und wiedererkennen und etwas über unser Bewusstsein erfahren? Das wäre fast schon wünschenswert.

Oder könnte es nicht sein, dass sie uns zusätzlich, gerade so, dass es nicht auffällt, „geheime Botschaften“ übermitteln, die zeitgleich und unbemerkt in unser Unterbewusstsein sickern? Das wäre sehr gefährlich und ein Grund mehr, sich mit Medienkritik und Medientheorie zu beschäftigen.
Die Frage, die man sich angesichts der Konstruiertheit in den Medien stellen sollte, lautet, ob uns Filme tatsächlich dazu verführen können, eine bestimmte (Welt)Sicht zu übernehmen. Schließlich ist es verhältnismäßig leicht, sich in jemand anderen hineinzuversetzen und eher schwer, in sich zu gehen und sich selbst ein Bild zu machen. Wir profitieren unser ganzes Leben lang von den Erfahrungen anderer und sind es ja gewohnt, die Gedanken und Bilder, die uns andere anbieten, erstmal ungefragt zu übernehmen.

Hier beginnt die Illusion.
Ob und in welchem Umfang wir das tun, hängt immer von Vertrauen und Nähe ab. Medien bzw. der Medienkonsum ist nun gerade so beschaffen, dass sie etwas Wesentliches ausblenden: die physische Nähe, über die emotionale Nähe und wiederum Vertrauen entstehen.
Diesen Bereich blenden Medien komplett aus. Aber natürlich dürfen wir davon nichts merken.
Es geht um das Problem, über das ich hier bereits geschrieben habe. Nämlich dass wir in einer dualistischen Welt mit vielen dualistisch operierenden Systemen leben: Religionen sind z. B. dualistisch, weil sie, entgegen ihrem Anspruch, eine Gemeinschaft zusammenzuhalten, die Tendenz zeigen, unsere physischen von unseren geistigen Bedürfnissen zu trennen.

Auch der Begriff der Liebe lässt sich nur erklären, wenn man Begriffe, die unsere geistigen Bedürfnisse wiederspiegeln (Glaube, Hoffnung und Zuversicht) in ihrem Zusammenhang mit unseren physischen Bedürfnissen (Umarmungen, Nähe, aber auch Essen) betrachtet.
Die physischen von unseren geistigen Bedürfnissen zu trennen, bedeutet, sich von einem natürlichen Gesamtzusammenhang zu lösen. Medien versprechen uns Vertrauen und wollen einen wichtigen Platz in unserem Leben einnehmen. Nämlich den, der eigentlich den Menschen unseres „inneren Kreises“ vorbehalten ist. Aber diesen wichtigen Platz können die Medien schon per Definition nicht einnehmen, weil sie zunächst nur in eine Richtung kommunizieren und lediglich auf unsere Zustimmung hoffen, aber nicht auf mehr.
Hier kommt der Konstruktivismus ins Spiel.
Ich stelle mir das so vor, dass wir (nach dem Modell des radikalen Konstruktivismus) im Grunde alle blind durchs Leben gehen und einfach jemand anderen brauchen, der die Welt mit uns erkundet und entschlüsselt. Das können Familienmitglieder, Freunde oder Lebenspartner sein. Allein schaffen wir es nicht. Und das wissen die Medien. Die Frage ist: Wollen oder sollten wir den Medien diese wichtige Aufgabe einfach so delegieren?
Ich möchte die Frage nicht einfach verneinen oder bejahen, denn letztlich sind wir ja auch wieder auf Medien angewiesen. Viel interessanter scheint es mir, sich einfach mal anzusehen, welche Weltinterpretationen sie uns vorschlagen.
Ich habe früher im Rahmen meines Germanistikstudiums einige Seminare über Medientheorie besucht. Darin haben wir Filme nach „versteckten Botschaften“ untersucht und uns genau diese Frage gestellt: Welche Welt bzw. welche Weltsicht schlagen uns die Filme vor?
Wie genau funktioniert das Ganze? Also. Aus konstruktivistischer Sicht (siehe meine Einleitung zum Thema Konstruktivismus) können wir uns quasi nie aus dem ganzen Weltzusammenhang bzw. der Ontologie lossagen und einen äußeren Standpunkt einnehmen. Wir klauben immer nur einzelne Symbole oder Reize aus ihrem Zusammenhang raus und geben ihnen eine bestimmte Bedeutung. Ob die schlüssig ist, wissen wir erst, wenn wir das Puzzle wieder zusammensetzen und wir das nun „etwas fertigere Puzzle“ betrachten und nachsehen, ob es einen Sinn oder zumindest mehr Sinn als vorher ergibt. (Ob es das tut, ist wiederum auch von unserer eigenen Konstruktion abhängig. Daher ist es ungemein wichtig, sich über solche Beobachtungen auszutauschen.)
So funktioniert die konstruktivistische Medienanalyse
Es gab zu meiner Studienzeit leider keine Literatur, die ich darüber befragen konnte, in welchem Zusammenhang der Konstruktivismus als erkenntnistheoretisches Konzept mit der konstruktivistischen Medientheorie, in der Form, in der wir sie damals anwandten, steht. Unser Professor hat uns immer nur selbst auf Literatur wie z. B. Niklas Luhmann's Liebe als Passion hingewiesen. Auch die Literatur, die ich unten angegeben habe, dient nur als Einstieg in die Theorie, aber nicht in die Praxis der konstruktivistischen Medientheorie bzw. Filmanalyse.
Daher nun meine kurze Angabe darüber, wie ich die konstruktivistische Interpretation von Filmen auffasse:
Die Analyse beginnt zunächst mit einem Zweifel bzw. einer wissenschaftlich vielleicht nicht ganz korrekten Unterstellung, die aber zur konstruktivistischen Medientheorie gehört:
Wir unterstellen erstmal grundsätzlich, dass große Publikumsfilme uns neben der eigentlichen Geschichte noch etwas anderes mitteilen möchten. Dass die erzählte Geschichte eigentlich nur die Rahmenhandlung für versteckte Botschaften ist. (Ja, jetzt wird es spannend. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt wie ein Detektiv oder eine Detektivin.)
So viel zum Setting.
Nun zur Durchführung:
Wir sehen uns einen Film an und haben zunächst ein Gesamtwerk vor uns. Als Zuschauer sind wir möglicherweise irgendwelchen emotionalen Regungen ausgesetzt. Aber als Interpreten dürfen wir uns nicht blenden lassen. Wir versuchen, Strukturmuster zu erkennen. Matrix verwendet zum Beispiel Farben, um uns auf verschiedene Sphären der Wirklichkeit hinzuweisen. Aber letztlich benutzt jeder Film ein anderes Strukturmuster. Star Wars lehnt sich wiederum an Campbells The Hero with the thousand faces an (Matrix übrigens auch, aber etwas subtiler).

Die Frage, die man sich bei der Suche nach Strukturmustern stellen sollte, lautet: Was ist der rote Faden des Films, welche (z.B. religiösen) Symbole und Farben benutzt er? Große Geschichtenerzähler bedienen sich meist an Themen und Motiven, die bereits Erfolg hatten. Matrix verweist zum Beispiel auf Alice im Wunderland und Der Zauberer von Oz. Es geht also häufig um große Erzählungen und auch Mythen. Aus der Patriarchatskritik weiß ich, dass gerade die Mythenumdeutung ein wunderbar effektives Instrument ist, um Menschen von einer neuen Religion und damit einem neuen Herrscher zu überzeugen.
In diesem Zusammenhang muss man sich natürlich die Frage stellen, wer eigentlich wen braucht: Brauchen wir die Medien, weil wir uns einem Ritual hingeben und gleichzeitig etwas Wichtiges über die Welt lernen möchten, oder brauchen die Medien uns, um ihre Botschaften zu verbreiten? Ist Filmemachen dann nicht auch mehr als nur ein einfaches Geschäftsmodell? Die Frage kann ich hier erstmal nicht beantworten. Aber es ist wichtig, dass sie an dieser Stelle einen Raum bekommt.
An diesem Punkt möchte ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Oder wie könnte ich es noch ausdrücken? Es geht darum, was meine konstruktivistische Medienanalyse so ergeben hat. Es geht um die Zuweisung eines Strukturmusters im Film zu einer Botschaft an den Zuschauer.
Die „Strukturmuster“ sind einfach nur kleine Schnipsel, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe. Sie stehen in keinem richtigen Zusammenhang und haben, streng konstruktivistisch betrachtet, auch keinen Wahrheitswert. Sie stehen für sich. Es sind Symbole, denen wir als medienkonstruktivistische Betrachter eine Botschaft zuweisen. Jedoch immer unter dem Aspekt der Interpretation. Wir sprechen hier über Thesen.
Bitte beachtet: Nur die erste Interpretation ist von mir. Die anderen habe ich während meiner Studienzeit und im Zuge meiner Beschäftigung mit der Patriarchatskritik gesammelt.
Die Eröffnungsszenen aus Matrix und Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter
Prinzessin Leia wird von Darth Vader gefangen genommen. Trinity wird von Polizeibeamten angegriffen und muss sich verteidigen.
Interpretation: Das weibliche Prinzip ist auf dieser Welt einer ständigen Bedrohung ausgesetzt.Der Geburtsmechanismus der Orks in Herr der Ringe
Interpretation: Die Orks, ihr freies, unkontrolliertes Gebären, repräsentieren eine alte, matriarchale Weltordnung, die unterdrückt werden muss, damit eine neue, patriarchale Weltordnung installiert werden kann.Michael Jacksons Video zu Earth Song
Interpretation: Männliche, in diesem Fall: Jacksons, Sexualität besitzt eine magische Potenz, die die Rettung für unsere zerstörte Umwelt ist.
Falls eines dieser Schnipsel bzw. Szenen bei auch auf Interesse stößt, kann ich gerne noch etwas detaillierter auf ihre Interpretation eingehen. Ich kann auch gerne noch detaillierter auf das Thema Mythenumdeutung eingehen. Diesen Bereich der Patriarchatskritik studiere ich zurzeit selbst noch (im Selbststudium), aber ich schreibe gerne, was ich bis jetzt darüber weiß.
Mir ist bewusst, dass jede Interpretation streitbar ist. Ich möchte hier daher auch keine Behauptungen aufstellen, sondern frage mich und damit auch euch, was an ihnen vielleicht dran sein könnte. Denn letztendlich klingen sie alle zumindest ein bisschen plausibel oder zumindest faszinierend. Zumindest für mich, denn sonst hätte ich sie hier nicht aufgenommen.
Das war in meinen Seminaren früher immer der Punkt, an dem unser Professor uns ansah und mit uns entweder über die Interpretationen diskutiert hat, oder uns bat, über unsere eigenen Medienbeobachtungen zu sprechen. Ihr dürft mir daher auch gerne eigene „Schnipsel“ und ihre möglichen Interpretationen vorstellen. Ich fände das sehr interessant. Wenn ihr möchtet, füge ich sie dem Artikel innerhalb der sieben Tage nach der Veröffentlichung hinzu. Auch, wenn ihr keine Interpretation habt. Manchmal ist vielleicht nur der Schnipsel interessant und die Interpretation fehlt. Das ist alles gut so, denn zusammen kann man dann ja weiterforschen.

Literatur:
- Rüdiger Wild: Konstruktivistische Medientheorie. Beobachter, Teilnehmer und Akteure in medialen Diskursen 2016
- Stefan Weber: Theorien der Medien: Von der Kulturkritik bis zum Konstruktivismus, Stuttgart 2010.
- Stefan Weber: Was heißt „Medien konstruieren Wirklichkeit“? Von einem ontologischen zu einem empirischen Verständnis von Konstruktion, in: Medienimpulse, Nr. 40, 2002: 11 – 16.
- Gebhard Rusch, Siegfried J. Schmidt, (Hrsg.): Konstruktivismus in der Medien- und Kommunikationswissenschaft. Frankfurt am Main 1997.
Meine Serie zum Thema Konstruktivismus:
1/7, Die Krise der Wahrnehmung
2/7, Die Geschichte des Konstruktivismus
3/7, Kants kritischer Realismus
4/7, Ontologische Systematisierung
5/7, Populäre Einwände
6/7, Soziologische Varianten des Konstruktivismus
7/7, Zusammenfassung und Ausblick
Gerade veröffentlicht:
[ENG] My steemit pearls week 14 ⚪
[DE - ENG] Korsika-Impressionen // Corse impressions
[DE] Die Veggie-Meldung der Woche: KW 14 🌱 💡
[DE] Was ich von den drei Fragezeichen über Steemit gelernt habe.
[ENG] My steemit pearls week 13
Bildquellen
1, 2, 3, 4, 5
painting "DUALISM" by @romanie, click here for her post
Icon made by https://www.flaticon.com/authors/freepik from https://www.flaticon.com
 |
|  |
|  |
|  }
}11.04.2018 UTC + 1